| Autor*in | Cormac McCarthy |
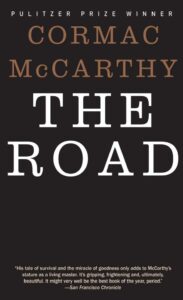 |
|---|---|---|
| Titel | The Road | |
| Verlag | Vintage International | |
| Erscheinungsjahr | 2006 | |
| Bewertung |      |
Foto oben: David Mark auf Pixabay |
Vater und Sohn gehen Straßen entlang. Diese sechs Wörter sind die maximale Kurzversion von The Road, und sie zeigen natürlich, wie radikal Cormac McCarthy in diesem Roman das Konzept „Plot“ reduziert hat. Und doch stecken in diesem Buch, das ihm den Pulitzer-Preis eingebracht hat und vom Time Magazine als bester Roman des Jahrzehnts gekürt wurde, sagenhaft viel Tiefe, Weisheit und Poesie. „Einfach und doch geheimnisvoll, gleichzeitig kryptisch und kristallklar“, hat die New York Times das genannt.
Dieser Effekt entsteht zum einen durch das Setting, in dem die beiden namenlosen Hauptfiguren (sie werden vom personalen Erzähler lediglich „the man“ und „the boy“ genannt) angesiedelt sind. Sie bewegen sich durch ein Amerika nach der Apokalypse. Fast alles um sie herum ist verbrannt, die Welt ist noch immer voller Rauch und Asche, die Sonne nur hinter einem Schleier zu erkennen, der ab und zu einsetzende Schnee sofort grau. Ob es ein Krieg war, der zu dieser absoluten Zerstörung geführt hat, eine Naturkatastrophe oder der Klimawandel, bleibt offen. Wir erfahren auch nicht, wann sich das Geschehen abspielt. Klar ist nur, dass die Veränderung sehr schnell kam. Die Kindheit des Vaters liegt 40 Jahre zurück, und er wuchs noch in einer Welt auf, wie wir sie alle kennen. Der Junge wurde gerade geboren, als diese Katastrophe ihren Lauf nahm, er kennt keine der Annehmlichkeiten des modernen Lebens und auch deshalb wundert sich der Vater noch jetzt über „the fragility of everything revealed at last“.
Denn die beiden sind in einer Phase der Post-Apokalypse angekommen, in denen die Plünderungen, Vergewaltigungen und Morde schon hinter ihnen liegen. Jetzt sind Verhungern und Erfrieren die neuen Gefahren. Und natürlich die paar anderen Menschen, die ebenfalls noch durch diese Einöde trotten. Denn ihre Verzweiflung könnte so groß sein, dass sie längst aufgehört haben, irgendwelche Skrupel zu haben und irgendeine Art von Moral zu bewahren. Gleich mehrfach stoßen Vater und Sohn auf Spuren von Kannibalismus, und das macht die Perspektive nicht angenehmer, was ihnen drohen könnte, wenn sie den falschen Leuten begegnen. Nichtsdestotrotz sind sie weiter auf dem Weg zum Meer, in der vagen Hoffnung, dort irgendeinen Rest von Zivilisation zu finden.
In einem Einkaufswagen hat das Duo die paar Dinge verstaut, die ihm das Überleben ermöglichen sollen, eine Plane zum Schutz gegen Regen, ein paar irgendwo aufgestöberte Konserven, auch ein Revolver mit nur noch zwei Schuss Munition. Dass diese Waffe nicht nur ein Mittel der Selbstverteidigung ist, sondern vielleicht auch die Erlösung aus all diesem Horror mittels Selbstmords bringen könnte, klingt in The Road immer wieder an. Wie wir nach einer Weile erfahren, hat die Mutter des Jungen diesen Weg gewählt, als klar wurde, wie unausweichlich die Härte der neuen Welt ist. „The boy was all that stood between him and death“, heißt es an einer Stelle auch über den Vater.
Zum anderen glänzt Cormac McCarthy hier mit einer Sprache, deren Meisterschaft ebenfalls in der Reduktion liegt. Die Dialoge zwischen den beiden Figuren sind meist ganz kurz, aber sie brechen einem trotzdem das Herz.“We’re going to be okay, aren’t we, Papa? – Yes. We are. – And nothing bad is going to happen to us. – That’s right. – Because we’re carrying the fire. – Yes. Because we’re carrying the fire“, ist so ein Beispiel.
Vater und Sohn sind „each the other world’s entire“, wie es heißt, sie leben eine fast symbiotische Abhängigkeit, die sie nicht als Last empfinden, sondern aus der sie ihre Stärke beziehen. Man spürt in The Road in jedem Moment die Erbarmungslosigkeit dieser Umwelt, und man spürt ebenso diese unbändige Liebe zwischen Vater und Sohn. Die Tragik erwächst dabei auch aus der Verunmöglichung des Versprechens, den eigenen Kindern einmal eine bessere Zukunft bieten zu können. An dessen Stelle stehen hier die Schuld, die Welt zerstört zu haben, und das schlechte Gewissen, in diesen Albtraum hinein auch noch Kinder geboren zu haben. Der Vater erkennt an einer Stelle, dass er für sein eigenes Kind wie ein Alien wirken muss, „a being from a planet that no longer existed“, und die Unmöglichkeit, hier eine echte Gemeinsamkeit zu stiften: „He could not construct for the child’s pleasure the world he’d lost without constructing the loss as well and he thought perhaps the child had known this better than he.“
Auch deshalb ist dieser Roman so spannend und erschütternd. Man bangt mit diesen beiden Figuren, auch wenn so überdeutlich ist, dass sie keine Chance haben. Der kleine Rest von Optimismus, den man empfinden darf, erwächst nicht zuletzt aus der Tatsache, dass dies ein Roman ist. Wir haben gelernt, dass die Helden in Büchern in der Regel nicht ohnmächtig gegenüber ihrem Schicksal sind, und bezeichnenderweise sind es an einigen Stellen auch Erinnerungen, Träume und nicht zuletzt Geschichten, aus denen die beiden Protagonisten ihre minimale Dosis an Hoffnung (und Bestätigung, dass es sich letztlich auszahlt, zu den Guten zu gehören) beziehen. „In seiner lapidaren Transkription der tiefsten Verzweiflung, die wir je erlebt haben, verkündet dieses Buch den Triumph der Sprache über das Nichts“, hat die Chicago Tribune richtig erkannt.
Die Geschichten spielen manchmal mit biblischen Referenzen, natürlich prägt The Road auch das uramerikanische Topos des Wanderns zur Küste in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Trotzdem hat Cormac McCarthy hier einen hochgradig ungewöhnlichen Roman hingelegt: Existenzialismus geht selten mit so vielen rührenden Passagen einher, Dystopien stecken normalerweise nicht voller Innigkeit, und man dürfte auch kaum so viele Landschaftsbeschreibungen erwarten in einer Welt, in der es kaum noch Pflanzen, keine Tiere und schon gar keine intakten Gebäude mehr gibt.
Überraschend ist auch, dass sich nicht der erwachsene Held als Schlüsselfigur von The Road erweist, sondern der kleine Junge. Er will verstehen und gut sein, was beides schwer genug ist innerhalb der Umstände ohne Ordnung und Menschlichkeit, in denen er aufwächst. er deutet ganz viel Lebensfreude und Neugier an, und nichts davon kann er ausleben. In ihm stecken eine Vernunft, Klugheit und Barmherzigkeit, die er in seiner Welt eigentlich nicht gelernt haben kann. Sie scheinen ein Gattungsmerkmal zu sein, doch auch dieser Gedanke scheint schnell widerlegt zu werden – denn die brutale Realität, in der er aufwächst, ist mit ihrer „Homo homini lupus“-Ausprägung der lebende Gegenbeweis.
Bestes Zitat: „No lists of things to be done. The day providential to itself. The hour. There is no later. This is later. All things of grace and beauty such that one holds them to one’s heart have a common provenance in pain. The birth in grief and ashes. So, he whispered to the sleeping boy. I have you.“

