| Autor | Benjamin von Stuckrad-Barre |
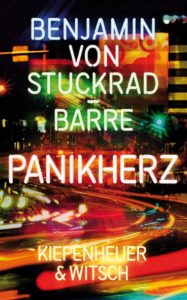 |
|---|---|---|
| Titel | Panikherz | |
| Verlag | Kiepenheuer & Witsch | |
| Erscheinungsjahr | 2016 | |
| Bewertung |      |
„Die Frage, ob einer seine Biographie schreiben dürfe, ist höchst ungeschickt. Ich halte den, der es tut, für den höflichsten aller Menschen. Wenn sich einer nur mitteilt, so ist es ganz einerlei, aus was für Motiven er es tut.“
Diesen Einwand bringt Goethe in der Bedeutung des Individuellen, und man sollte sich diese Worte vielleicht in Erinnerung rufen, bevor man mit der Lektüre von Panikherz beginnt. Benjamin von Stuckrad-Barre legt damit sein erstes Buch seit Auch Deutsche unter den Opfern (2010) vor, es ist also so etwas wie ein Comeback. Und es ist so etwas wie eine Autobiographie.
Fans, die seit dem umwerfenden Soloalbum (1998) auf einen neuen Roman warten, werden vielleicht enttäuscht sein von dieser Nachricht. Gegner, die in Stuckrad-Barre schon immer nur den überdrehten Emporkömmling gesehen haben, werden es sagenhaft eitel finden, dass ein 41-jähriger Autor erst jahrelang gar kein Buch schreibt und dann mit einer Veröffentlichung auftaucht, dessen wichtigster Inhalt, schon wieder, er selbst ist.
Dabei findet Stuckrad-Barre eine höchst ungewöhnliche (und gelungene) Form für dieses Buch: Es ist zugleich eine Autobiografie und die Geschichte seines lebenslangen Fan-Seins mit und für Udo Lindenberg. Immer abwechselnd gibt es ein Kapitel aus der Lebensgeschichte des „wahrscheinlich größten Talents, das der auf Popkultur spezialisierte Journalismus in den vergangenen Jahren gesehen hat“ (FAZ) und ein Kapitel, das im Chateau Marmont in Hollywood spielt, wo er sich in Klausur begeben, dann auf sein Leben zurückgeblickt und dieses Buch verfasst hat.
Es ist der ältere Bruder, der den kleinen Benjamin von Stuckrad-Barre zum Udo-Lindenberg-Fan macht, und der Mann mit dem Hut wird für ihn erst zu einer mythischen Rock’N’Roll-Inkarnation, dann zum Freund und Mahner, schließlich zum Retter. Eine fast kindliche Zuneigung zu diesem Helden spricht aus dem Buch, die dem Autor völlig bewusst ist: „Udo (…) kam mir jetzt vor wie eine Märchenfigur, um ihn herum nur Nebel, er aber klar erkennbar, Hut, Sonnenbrille, Gehrock, mir angenehmer Schlendergang, auf und durch seine Art leuchtend, mein Stolpern bis hierher ein einziger Irrweg, wo war ich nur so lange gewesen, war doch hier mein geistiges Zuhause. Hamburg, Atlantic, Udo“, schreibt er an einer Stelle.
Man kann aus diesem Buch wahrscheinlich mehr über das Wesen von Udo Lindenberg lernen als aus Panikpräsident, dessen eigener Autobiografie. Zuerst Herz statt zuerst Hirn, lieben statt hassen, umarmen statt anpissen – das sind die Werte, für die Udo Lindenberg hier steht, die Benjamin von Stuckrad-Barre an ihm schätzt und so gerne auch selbst verkörpern möchte.
Die Bewunderung funktioniert dank dieser Eigenschaften, aber auch dank des Berufs des Bewunderten: Lindenberg ist Popstar, und die Reflexionen über das Zusammenspiel von Musik und Biographie gehören zu den besten Passagen von Panikherz. Stuckrad-Barre weiß um die Überhöhung, Verklärung und Nostalgie, die einen Pop-Fanatiker auszeichnen. Musik, und im weiteren Sinne die Popkultur insgesamt, seziert er hier als „eine weitreichende Ichentwurfssetzung“ und immer wieder legt er dabei eine Begeisterungsfähigkeit an den Tag, die ebenso mitreißend wie überraschend ist von einem Mann, der einst immerhin sein Geld damit verdient hat, zynische Witze für Harald Schmidt zu schreiben.
Ganz eindeutig spielt die Musik in seinem Leben auch deshalb eine so große Rolle, weil sie sich als ideales Vehikel für das wichtigste Thema dieses Buchs eignet: die Flucht aus dem Ich. Party und Drogen sind die weiteren Mittel der Wahl, und das macht Panikherz zu einer Geschichte über Rausch und Absturz, Kokain und Bulimie, euphorische Nächte in Hamburg, Berlin und Zürich und dunkle Wochen in der Entzugsklinik.
Stuckrad-Barre ist schonungslos bei dieser „Reise ins Herz der Finsternis der westlichen Popkultur“ (Frankfurter Neue Presse). „Wieder zuhause, machte ich mich daran, endgültig alles zu zerstören. Alle zwei Tage kam der Dealer, die Nächte verbrachte ich im Bordell, ich schlief gar nicht mehr, nur alle fünf Tage mal, dann aber so tief und betäubt, dass ich hernach sehr lange brauchte, mich zu orientieren – war es jetzt immer noch dunkel oder schon wieder?“, ist fast noch eine der harmloseren Passagen über seinen Absturz. Dennoch ist es beim Lesen solcher Zeilen kaum zu glauben, dass er rund zehn Jahre später in einem so aufgeräumten Zustand ist, dieses Buch zu schreiben.
„In Panikherz erzählt Stuckrad-Barre aus dem Backstage-Bereich dieser Show, die sein Leben war. Von dem Glanz und dem Dreck, von der Lust und den Schmerzen dieser Jahre und wie er sie erst gesteigert und dann betäubt hat, mit Musik, dann mit Alkohol, mit Drogen, bis es nicht mehr ging. Er seziert wieder, diesmal sich selbst“, hat der Stern das Buch recht treffend zusammengefasst. Der Autor gibt sich dabei, und das ist der entscheidende Aspekt für die Ehrlichkeit, die man diesem Buch attestieren möchte, nicht als geläutert, sondern thematisiert immer wieder die Versuchung, die in ihm steckt, die Sehnsucht nach einem Lifestyle, der nun einmal als Ideal all dessen gilt, was die Popkultur ausmacht. „Diese Abende als Rutschpartie, dass man das Haus verlässt und wirklich unklar ist, wann man wiederkommt und mit wem, wo alles endet und warum es dann doch noch weiterging und dazwischen zwei Tage Erinnerungslosigkeit klaffen, einfach diese ungebremste Abfahrt, das Irrationale, das fehlt mir“, heißt es beispielsweise.
Die Suche, das Ringen und die Entbehrung sind offensichtlich aufrichtig, aber Benjamin von Stuckrad-Barre ist zu sehr Prahlhans, um damit Mitgefühl zu wecken – und das verlangt er auch gar nicht. Ganz offensichtlich hat er, mit klarer Sprache und großem Tempo, Freude daran, nicht nur den erbärmlichen Niedergang in seinen Momenten als Süchtiger zu zeigen, sondern auch das Gloriose seines rasanten Aufstiegs.
Thomas Gottschalk erzählt ihm an einer Stelle des Buchs, er habe beim Schreiben seiner Autobiographie Herbstblond „manches weglassen müssen, was zwar die Wahrheit sei, aber nach Angeberei klinge“. Stuckrad-Barre betrachtet das als einen „mir vollkommen fremden Ansatz“. Und so gibt es reichlich Prominenz in diesem Buch, und viele schillernde Anekdoten. Der Leser erfährt, wie Stuckrad-Barre als Schüler zum Drogenkurier für Rio Reiser wurde, wie er die Bates überredet hat, auf seiner Abi-Feier auf dem Schulhof in Göttingen zu spielen, warum Sven Regener einmal bei ihm den Kühlschrank geputzt hat, wieso er sich bei einem Brian-Wilson-Konzert mit Thomas Gottschalk nicht amüsieren konnte, wie es sich anfühlt, Bret Easton Ellis zu küssen, oder warum er bei einer Lesung von Elvis Costello zwischendurch nackt sein musste.
Panikherz hat genug Ironie und vor allem Selbstironie zu bieten, um das nicht unsympathisch wirken zu lassen. Vielleicht ist dieser wiederholte Verweis auf spektakuläre Begegnungen auch als Erinnerung an sich selbst und an sein Publikum gedacht, wie viel er zu erzählen hat. Denn ganz deutlich ist dieses Buch auch der Versuch, Autonomie zurückzugewinnen, die Herrschaft über das eigene Werk, das eigene Image. Nicht mehr Objekt von Anekdoten, Klatsch und Tratsch oder Nostalgie, sondern Subjekt.
Seinen Kritikern galt Benjamin von Stuckrad-Barre immer eher als einer, der aufschreibt, als einer der schreibt. Eher als jemand, der beobachtet, als jemand, der aus der Krafts eines eigenen Geistes heraus erschafft. Einen Autor, „der sich selbst bis aufs Schmerzhafte zum Sujet gemacht hat“, nennt ihn der Deutschlandfunk, und darin liegt auch der Zweifel, ob dieser Autor auch anderen Sujets gewachsen wäre. Es ist ein Makel, den er vielleicht sogar selbst empfindet. „Ich hatte (…) das unterschwellige Gefühl, das mich bis heute nie ganz verließ: Gleich kommt meine Mutter rein, macht das Licht an und fragt, was denn hier los ist, und dann fliegt der ganze Schwindel auf und alles ist vorbei“, schreibt er an einer Stelle des Buches.
Mit Panikherz erweist sich Benjamin von Stuckrad-Barre als Autor im besten Sinne. Das macht Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann doch noch einmal einen Roman aus seiner Feder geben wird. Nach diesem Buch möchte man wetten, dass er großartig wäre.
Bestes Zitat: „Udos Werk und Udos Auftritte empfand ich von Beginn an als Werbung für den Rausch als solchen, Rausch als Spaß und Selbstzweck, Rausch aber auch als Protest, als Haltung. Als Art, durchs Leben zu taumeln und nur sehr ausgewählt die permanenten Ernsthaftigkeitsangebote der Umwelt anzunehmen.“
