| Autor | Henri Charrière |
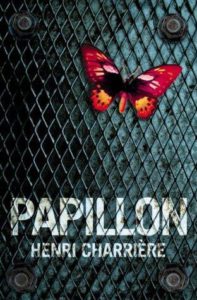 |
|---|---|---|
| Titel | Papillon | |
| Verlag | Lingen | |
| Erscheinungsjahr | 1970 | |
| Bewertung |      |
15 Millionen Leser hatte Papillon bereits gefunden, als die Geschichte 1973 als Film mit Steve McQueen und Dustin Hofmann ins Kino kam. Da war die Lebensgeschichte von Henri Charrière gerade erst seit drei Jahren auf dem Markt. Keine schlechte Bilanz für einen Autor, der sich zu Beginn selbst als Dilettant bezeichnet und die Handlung des Romans, der von seinem Leben in einer Sträflingskolonie in Französisch-Guayana und seinen zahlreichen Fluchtversuchen handelt, handschriftlich in 13 Schulheften niedergelegt hat, die auch die Gliederung bilden.
Der Reiz dieses Bestsellers ist dabei nicht schwer zu erklären: Erstens ist es die Authentizität, die im Vorwort des Herausgebers Jean-Pierre Castelnau noch „voll und ganz“ verbürgt wird: Neben dem Hinweis auf die Schulhefte findet sich dort auch der Vermerk, das Manuskript des Ex-Häftlings habe etliche Rechtschreibfehler enthalten, die verbessert wurden, sonst sei aber alles unangetastet geblieben. Im Stil merkt man dem Buch das durchaus an: Von großartiger Prosa oder sprachlicher Finesse ist der Roman weit entfernt. Wie wir heute wissen, hat Charrière seinen eigenen Erlebnissen durchaus auch ein paar Anekdoten hinzugefügt, die andere Häftlinge ihm erzählt haben, wohl auch ein paar erfundene Passagen gibt es in Papillon. Aber den Reiz, hier die echte Stimme eines Manns zu hören, der ein Drittel seines Lebens um seine Freiheit gekämpft hat, schmälert das kaum.
Das ist der zweite wesentliche Faktor für die Anziehungskraft dieses Romans: Alles ist ausgerichtet auf eine einzige Idee, von Anfang an, und trotz größter Widerstände und ohne Rücksicht auf die Lebensgefahr, in die er sich begibt, rückt der Held in keinem Moment von dieser Idee ab. „Ich habe keine Angst. Denen werd‘ ich’s zeigen. Ich werde gegen sie kämpfen, gegen sie alle! Schon morgen fang‘ ich damit an“, heißt einer seiner ersten Gedanken bei der Ankunft in der Sträflingskolonie in Cayenne. 1933 kommt Papillon als 27-Jähriger dort an, er hat zuvor ein Lotterleben im Montmartre geführt und wurde dann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
Papillon beteuert seine Unschuld und es ist zunächst der Umstand, dass er sich ungerecht behandelt fühlt, der seine Gedanken an Flucht antreibt. Er will raus aus dem Lager und zurück nach Paris, um diejenigen zur Rechenschaft ziehen zu können, die ihn verraten, verleugnet, angeklagt und verurteilt haben, und die Fantasien seiner Rachegelüste sind, zunächst in Frankreich, dann auf der Überfahrt in die Tropen, schließlich im Bagno, von einer gehörigen Portion Sadismus befeuert. Darin liegt einer der ersten großen Unterschiede zur ebenso erfolgreichen Verfilmung, in der diese dunkle Seite Papillons – der stattdessen als unbeugsamer, aufrechter Held stilisiert wird – keine Rolle spielt. Eine beträchtliche Abweichung ist auch die Tatsache, dass man hier durch die Rolle von Charrière als Ich-Erzähler von Beginn an weiß, dass ihm die Flucht letztlich gelingen wird. Das führt zu einer Verlagerung des Spannungsmoments, auch des eigentlichen Themas von Papillon: Als Buch ist dies viel stärker als der Film die Geschichte einer Politisierung.
Das beginnt damit, dass Papillon – der in Paris wohl eher gebrochene Herzen hinterlassen hat als gute Freunde – den Wert von Kameradschaft kennenlernt, an erster Stelle durch die Freundschaft mit dem Geldfälscher Dega. Schon bald entwickelt sich daraus ein Blick auf die sehr unterschiedlichen Werte- und Sozialsysteme im Milieu der Wärter und in der Welt der Häftlinge. „Dort die Feigheit, die pedante seelenlose Autorität, der intuitive Sadismus mit seinen automatischen Reaktionen – und hier ich. Ich und die Männer meiner Kategorie, die sich zwar auch schwere Verfehlungen zuschulden kommen ließen, sich aber durch ihre Leiden unvergleichliche Qualitäten erworben haben: Mitgefühl, Güte, Opferbereitschaft, Seelengröße, Mut.“
Daraus erwachsen schließlich Gedanken über Vaterland, Humanität und Religion, die dem unpolitischen und hedonistischen Mann in seiner Pariser Zeit wohl völlig fremd gewesen wären, und ihn an einigen Stellen des Buchs fast wie einen modernen Spartacus erscheinen lassen. „Ich sehe mir die Zelle an. Niemals wäre ich je auf die Idee gekommen, dass ein Land wie Frankreich, die Mutter der Freiheit der ganzen Welt, auf dessen Boden die Menschen- und die Bürgerrechte geboren wurden, (…) eine so barbarische Einrichtung haben könnte wie das Zuchthaus von Saint-Joseph“, ist so ein Beispiel. Dass er schließlich als ehrenwerter, geachteter Mensch mit der Staatsangehörigkeit von Venezuela leben kann, verdankt der gebürtige Franzose nach seiner erfolgreichen Flucht der Tatsache, „dass dieses Volk seinen Blick und sein Wort höhergestellt hat als den Auszug aus seinem Strafregister; dreizehn Jahre voll hartnäckig wiederholter Ausbrüche und Kämpfe, um der Hölle des Straflagers zu entrinnen, stellten ihn mehr in das Licht der Zukunft als in den Schatten der Vergangenheit.“
Es ist schließlich nicht mehr die Lust auf Rache, die Papillon bei der Flucht antreibt, sondern die Sehnsucht nach dieser Anerkennung seines eigentlichen Wertes, nach Respekt für das, was seinem Herzen und seinen Taten entspricht, nicht seiner Gerichtsakte. Deshalb gibt er sogar das idyllische Leben bei einer Indianerfamilie wieder auf, dass er als Zwischenstation bei einem seiner Fluchtversuche eine zeitlang genießt. Auch diese Episode zeigt: Das Leben der Ureinwohner und das Miteinander der Häftlingen sind geprägt von Menschlichkeit und Loyalität, die vermeintlich zivilisierten Systeme von Justiz und Polizei hingegen von Korruption und Willkür. Vor diesem Hintergrund wird auch die Frage, ob er tatsächlich einen Mord begangen hat oder unschuldig im Bagno gelandet ist, immer unwichtiger. Mit jeder Seite des Buches wird deutlich: Eine solche Behandlung hat niemand verdient, egal welches Verbrechen er begangen hat.
Bestes Zitat: „Eine Nation hat weder das Recht, sich zu rächen, noch Leute, die der Gesellschaft zum Ärger gereichen, einfach auszustoßen. Es sind Menschen, denen man eher Fürsorge angedeihen lassen müsste, als sie so unmenschlich zu bestrafen.“
