| Autor | Udo Lindenberg |
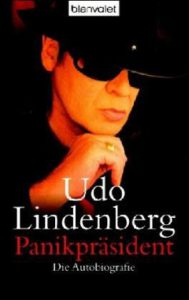 |
|---|---|---|
| Titel | Panikpräsident. Die Autobiografie | |
| Verlag | Blanvalet | |
| Erscheinungsjahr | 2004 | |
| Bewertung |      |
Wenn man heute die Autobiografie von Udo Lindenberg liest, die er in Zusammenarbeit mit dem Journalisten Kai Hermann geschrieben hat, muss man sich zunächst das Erscheinungsjahr noch einmal klar machen: Panikpräsident wurde 2004 veröffentlicht. Das letzte Top-10-Album von Udo Lindenberg lag da bereits 20 Jahre zurück, seit Ich will dich haben (1991) hatte er es mit seiner Musik auch nicht mehr in den Top20 der deutschen Charts geschafft. Udo Lindenberg war damals ein Auslaufmodell.
Er feierte zwar sein 30. Bühnenjubiläum und stand für RTL mit jungen Gesichtern wie Yvonne Catterfeld vor der Kamera, er erhielt wenig später Auszeichnungen für sein Lebenswerk oder wurde als Illustrator für Meyers Großes Taschenlexikon engagiert. Dass er 2008 aber mit neuen Songs und dem Album Stark wie zwei noch einmal richtig abräumen sollte, dass ihm ein neues Karriere-Hoch mit zahlreichen Huldigungen wie MTV Unplugged, einem Musical oder der unsterblichen Liebe von Benjamin von Stuckrad-Barre bevorstand, zeichnete sich damals in keiner Weise ab.
Gerade vor diesem Hintergrund ist es geradezu aufregend, wie selbstbewusst er in Panikpräsident ist. „Unbescheidenheit ist seine Zier“, heißt es schon auf den ersten Seiten, und diesem Prinzip folgt Udo Lindenberg dann mit großer Lust. „Er verkündet die Heiligsprechung des Individuums. Und er singt das Hohe Lied der Solidarität gegen Dumpfbacken und Brutalos. Die Form bleibt flexibel. Ein bisschen Slapstick, etwas Tragikomödie, viel Helden-Epos. Die Ausstattung ist üppig“, kündigt die Einleitung an, und dieses Versprechen wird dann auch gehalten. Der Karriereplan stand demnach sehr früh fest: Weltstar.
Erstaunlich ist nicht nur, mit wie viel Überzeugung Udo Lindenberg dieses Ziel verfolgt hat (als seine Grundprinzipien zählt er an einer Stelle auf: Hoffnung, Optimismus, Konsequenz), sondern auch, dass er überhaupt so hochfliegende Pläne schmiedete. Denn das Buch zeigt sehr deutlich, dass er in einem denkbar unpassenden Umfeld für Fantasie, Herausforderung und Nonkonformismus aufwuchs: Mief und Prüderie der bundesdeutschen Provinz in den 1950er Jahren prägen das erste Drittel der Autobiografie.
Die Schatten des Krieges sind für den 1946 in Gronau/Westfalen geborenen Lindenberg noch sehr präsent, ebenso der Versuch seiner Umwelt, durch ein Übermaß an Disziplin, moralischer Strenge und Sittsamkeit den Gedanken an eigene Verantwortung oder gar eigene Verbrechen während der Nazi-Herrschaft zu verdrängen. „Die Lebenslügen vergiften auch den Heranwachsenden. Sie werden ihm jeden Tag eingeträufelt, in der Schule, in der Familie. Damit der Junge ja so wird wie alle anderen: normal“, bringt der Autor dieses Gefühl von Enge und Bigotterie auf den Punkt.
Der Autortext über Udo wird in Panikpräsident dabei immer wieder unterbrochen von kursiv gesetzten Passagen von Udo, die nur gelegentlich den typischen Udo-Sound bieten, dafür aber viel zur Legendenbildung beitragen und einen erstaunlichen Mut zur Offenheit beweisen. Erektionsprobleme oder sein Alkoholismus schon in frühesten Teenager-Jahren gehören dazu, auch amüsantere Anekdoten wie die Tatsache, dass er kurz mit einer Karriere als Zuhälter und später als Mafioso in Little Italy liebäugelte.
Mit solchen Einblicken stellt er natürlich seine Coolness und Weltgewandtheit heraus, aber auch offene Wunden gibt es in diesem Buch: den frühen Tod des Vaters beispielsweise, dem er gerne noch bewiesen hätte, dass er es als Musiker zu wirklich großem Erfolg schaffen kann, die von der Stasi beendete Liebe zum Mädchen aus Ostberlin oder die gescheiterte Beziehung mit Nena. Lindenberg kennt durchaus Selbstzweifel, wie er an einer Stelle einräumt, als es nach einer vielversprechenden Möglichkeit mal wieder einen Rückschlag gab: „Eine der Macken sagte dir, du bist doch schon als Loser von der Entbindungsstation gekommen. (…) Aber dann ist da die Macke Nummer 2, die dir unbeirrt einflüstert: Du bist der Größte. Es ist nur noch nicht an der Zeit, das Tarnhemd der Bescheidenheit in die Altkleidersammlung zu geben.“
Die Verbindung zwischen beidem ist das Image, das Lindenberg für sich und von sich kreiert. Mit dem scheinbar arroganten, unfehlbaren, stets leicht angeheiterten Unikum gelingt es ihm, die eigene Unsicherheit ins Gegenteil zu verkehren, in einen Panzer aus Unanfechtbarkeit zu verwandeln. Nicht nur für seine Psyche, sondern auch für seine Karriere erweist sich dieser Einfall als entscheidend. Dass Udo Lindenberg eine Kunstfigur ist, daran lässt er keinen Zweifel. Er zeigt in diesem Buch, wie er diese Figur erfunden, einstudiert und perfektioniert hat – und er beschreibt, wie sein eigentliches Ich dann nach und nach mit dieser Figur verschmolzen ist.
Nicht zuletzt bringt Panikpräsident, auch da ist das Erscheinungsjahr wichtig, etliche Tatsachen in Erinnerung, die man vor lauter Klamauk und Legendenbildung heute gerne vergisst: seine Jazz-Meriten als virtuoser Schlagzeuger, seinen mühsamen Weg zum Durchbruch (der in diesem Buch, ebenso wie Kindheit und Jugend, genauso viel Raum einnimmt wie die Jahre des Erfolgs) und vor allem seine Rolle als Pionier für Rock mit deutschen Texten. „Es war Zeit, den Deutschen den aufrechten Straßenjargon zurückzubringen. Mit deutschem Rock’N’Roll“, hat er eines Tages beschlossen, und wie unerhört diese Idee damals sein musste, macht Panikpräsident noch einmal sehr anschaulich. Udo Lindenberg war verantwortlich für die Pulverisierung der Schlager-Vorherrschaft und für den Beweis, dass man auch als Junge aus dem Münsterland ein geborener Star sein kann, mit grandioser Bühnenshow, spektakulärem Privatleben und politischer Meinung. Und natürlich: mit Hut.
Bestes Zitat: „Dass ich mit meiner Stimme nicht bei den soundsoviel Tenören auftreten könnte und auch keine RTL-Casting-Vorausscheidung bestanden hätte, ist eine der Gaben der Götter. Denn zu dem, was ich sang, passte nichts anderes. Auch wenn meine dünne Mülltonnenstimme immer besser wurde, blieb die gewollte Wirkung auf das geneigte Publikum. Die Menschen meinten, so wie der tönt, würde ich auch singen, wenn man mich nur ließe. Die Songs kamen deshalb nicht irgendwie abgehoben daher. Sie machten klar, der da oben auf der Bühne gehört zu euch da unten im Saal.“
