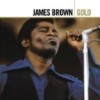
| Künstler | James Brown |
| Album | Gold |
| Label | Universal |
| Erscheinungsjahr | 2005 |
| Bewertung | *** |
Say It Loud, I’m Black And I’m Proud. Dieser Slogan, dieser Refrain, dieser Song wurde nicht nur zu einem der größten Hits in der Karriere von James Brown, die fast 50 Jahre und mehr als 60 LPs umfasst. Es wurde auch sein Credo. „Browns forceful testimony for black consciousness and pride was the most aggressive, vehement attack an racist America to date“, schreibt Louis vom Mojo-Magazin in den Liner Notes über den Song aus dem Jahr 1968 ganz richtig.
Das extrem beschwingte Stück mit seinem unwiderstehlichen Call-and-Response-Gesang war ein Statement, das länger nachwirkte als alles andere in der Karriere von James Brown. Als der Godfather Of Soul an Weihnachten 2006 starb, wurde er natürlich betrauert wegen seiner Musik, seinem Showtalent, seiner Kreativität im Studio und auf der Bühne. Aber vor allem, weil er prototypisch für den Traum stand, den viele Afroamerikaner träumten und träumen: James Brown hat es mit viel Talent und noch mehr Ehrgeiz ganz nach oben geschafft – und auf dem Weg dorthin den Weißen seine eigenen Regeln aufgezwungen. So wurde James Brown zum schwarzen Idol.
Vielleicht das legendärste Beispiel dafür: Das epochale Album Live At The Apollo wollte sein Label 1962 nicht herausbringen. James Brown aber glaubte fest an die Idee eines Live-Albums, bezahlte die Aufnahmen kurzerhand selbst , landete damit seinen ersten Millionenseller – und legte quasi nebenher noch den Grundstein für ein ganzes Genre. Einige Songs von James Brown funktionieren heute kaum noch – es ist eben die Tanzmusik von vor 40 Jahren. Sieht man den Meister aber dazu auf der Bühne, machen auch die schwächsten dieser Stücke wieder Sinn.
Stur und stolz, voller Selbstbewusstsein und doch ständig um Anerkennung von außen heischend, stets um Integrität bedacht, aber auch keine Gelegenheit zur Selbstvermarktung auslassend – das war James Brown. Gold, der Überblick seines Schaffens aus den Jahren 1956 bis 1985 (also dem Kern seines Oeuvres), zeichnet seinen Weg eindrucksvoll nach. Und dabei wirft die Greatest-Hits-Rückschau sehr schnell auch einen sehr erstaunlichen Aspekt auf: Besonders schwarz war an der Musik von James Brown fast nichts.
Jedenfalls nicht schwarz im Sinne von: afrikanisch. Die traditionelle Musik vom schwarzen Kontinent zeichnet sich durch einen enormen Willen zum Zusammenspiel aus, zur Harmonie. Sie begleitet das Leben, sie feiert oder betrauert es – aber sie stellt es nicht in Frage. Davon ist bei James Brown keine Spur mehr. Er hat aus Afrika nur den Rhythmus übernommen und ihn in seiner Musik mit einer durch und durch amerikanischen Eigenschaft vermengt: Aggressivität.
Zu Beginn seiner Karriere, wie in den pathetischen Schmachtfetzen Please, Please, Please oder Try Me kann man das zwar in der Musik noch nicht ausmachen. Aber auch da war Aggressivität bereits Teil von James Brown – sie äußerte sich in seinem enormen Ehrgeiz. Der junge Mann, der nach schwerer Kindheit mit 15 die Schule geschmissen und mit 16 wegen Autodiebstahls zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, hatte Musik zunächst als Zufluchtsort und dann als Karrierechance entdeckt – und wollte nichts anbrennen lassen.
Das brachte ihm nicht nur den Ehrentitel als „hardest working man in showbusiness“ ein (allein in den ersten zehn Jahren seiner Karriere nahm er unfassbare 22 LPs auf), sondern sorgte auch dafür, dass er das Publikum und dessen Geschmack stets sehr genau im Auge hatte. Die Suche nach dem ultimativen Hit vermengte sich so mit seinem musikalischen Innovationsdrang zu einer sehr fruchtbaren Kreativität.
1960 brachte das Album Think die erste saftige Ernte ein. Sein Soul-Sound hatte nun mehr Power bekommen, der Titelsong beeindruckt noch heute mit seinem fast maschinell-kraftvollem Beat, der verspielten Gitarre und der cleveren Start-Stop-Dynamik der Bläser.
Zwei Jahre später legte er den Grundstein für den Funk-Sound, der ihn schließlich definieren, in den frühen 1970ern mit einer zusätzlichen Prise Jazz dann Monsterhits wie Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine oder das nach wie vor brennend heiße Super Bad hervorbringen und ein paar Jahre später eine ganze Reihe von Stücken, die arg nach Selbstparodie klangen, verursachen sollte: Das fast instrumentale Night Train spielt erstmals mit synkopierten Beats, virtuosem Bass und Bläsern, die immer wieder wie eine Axt in das Rhythmusfundament schlagen.
Das war sexy, packend und das perfekte Klanggewand für James Browns irre Bühnenshows (und noch Jahrzehnte später eine Fundgrube für HipHop-Größen, die James Brown zum meistgesampleten Mann der Welt machten). Drei Jahre Später kannte alle Welt James Brown nur noch als Funkateer (ein Titel, der viel besser zu ihm passt als die irreführende Lobhudelei als Godfather Of Soul, die man beispielsweise Sam Cooke oder diversen Stax-Größen viel eher zukommen lassen könnte).
In Papa’s Got A Brand New Bag kamen die neuen Zutaten erstmals zur Explosion. Die Fanfare am Beginn läutete die nächste Phase in der Karriere von James Brown ein, denn der Song wird 1965 seine erste Top-10-Single. Es folgen Klassiker wie das unwiderstehlich optimistische I Got You (I Feel Good) und Meisterwerke wie It’s A Man’s Man’s World oder (deutlich später) King Heroin, die laut Louis Wilson belegen, dass James Brown nicht nur ein irrer Sänger und famoser Tänzer war, sondern auch „an intelligent philosopher in song“. Spätestens ab jetzt spielt er in der ersten Liga – und will es erst recht allen zeigen.
„Allen“ heißt dabei auch und vor allem: den Weißen. Das Wort „Crossover-Erfolg“ gab es damals noch nicht, doch es dürfte für James Brown eine unendliche Genugtuung gewesen sein, als seine Musik die Mod-Szene in England infizierte und The Who 1965 seinen Song Shout auf der B-Seite von My Generation coverten.
Es ist das Phänomen der Zerrissenheit, das Horace Slim in seinem Kultbuch Pimp so gut auf den Punkt gebracht hat, und das sich in vielen schwarzen Biographien findet, von Chuck Berry bis Michael Jackson, und quasi prototypisch auch hier: Ehrgeiz, der durch Missachtung hervorgerufen wird. Erfolg, der seinerseits wieder Diskriminierung hervorbringt, und auch bei James Brown immer wieder egtrübt wird von Ärger mit der Polizei (Drogen, Prügel, Steuern).
Gerade seine Begierde hinsichtlich der Akzeptanz der Weißen war eine Triebfeder in James Browns Schaffen, aber im Laufe seiner Karriere auch befremdlich für die Schwarzen, von denen er sich ebenso bereitwillig als Sprachrohr verehren lassen wollte. Mit Money Won’t Change You (1966) beschwor er noch die eigenen Wurzeln, später unterstützte er Nixon und Reagan im Wahlkampf. Er sympathisiert mit den Black Panthers, singt aber auch für die US-Armee in Vietnam. Ein gewagter Spagat – und ein Dilemma, in dem sich Brown im Zweifel immer für die Seite entschied, die ihm selbst die größten Vorteile versprach.
Die Symbiose (wenn auch keineswegs die Versöhnung mit allen seinen Zielgruppen) findet er in der Rolle als konservativer Patriot, ob mit America Is My Home (1967) oder noch 1985 mit Living In America. Mehr als ein Held der Schwarzen ist James Brown deshalb vor allem: an American Idol.
Kein Wunder, dass solch ein Showmann die Idee erfunden hat, ein Live-Album zu machen: James Brown singt Try Me live at the Apollo:
httpv://www.youtube.com/watch?v=xnAfit_FYzI

2 Gedanken zu “Hingehört: James Brown – „Gold“”